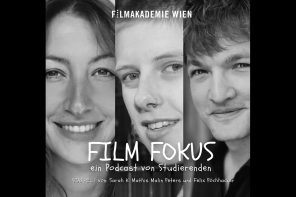Ein Brückenbau zwischen mehreren Disziplinen, im Konkreten zwischen der Sozialwissenschaft und dem Film, aber andererseits zwischen Gesellschaftsgruppen, stand von 2021 bis 2025 im Zentrum des Projektes BUILDING BRIDGES in Polarized Societies: Film – Wien – ArbeiterInnenmilieu – Rechtspopulismus. Geleitet wurde dieses von Barbara Wolfram, Film- und Theaterregisseurin sowie selbst Forscherin, und Paulus Wagner, Sozialwissenschaftler mit Forschungsschwerpunkten unter anderem in den Bereichen Sozialpolitik und Arbeit.
„In der qualitativen Sozialwissenschaft geht es oft darum, Menschen im Detail zu verstehen und Konversationen herzustellen. Film wiederum ist das dominante Medium unserer Zeit. Auch in den sozialen Medien werden mit Videos Identitäten konstruiert“, erklärt Wagner. Durch einen medialen Diskurs entstehe dann eine Form der Anerkennung. Es gehe darum, wie und ob gesellschaftliche Gruppen einander sehen und verstehen oder dies nicht tun.
Wagner führte vor dem gemeinsamen Projekt rund 150 biografische Interviews mit verschiedenen Personen aus dem Arbeiter_innenmilieu, und auch Wolfram entwickelte zuvor anhand von Biografien Theaterstücke. „Wir hatten uns beide bereits mit ähnlichen Themen befasst und dann kam 2021 zum richtigen Zeitpunkt der Artistic Research Call der Stadt Wien“, erklärt Wolfram. Mit der finanziellen Unterstützung konnten in den letzten Jahren an der Filmakademie Wien das Projekt umgesetzt und zwei Kurzfilme produziert werden. Von den in Interviews festgehaltenen Biografien zum fertigen Film war es aber ein längerer Prozess. „Es geht darum, zu verstehen und zu konstruieren. Aber auch um ein Erinnern. Film ist ein Medium, das lange bestehen wird und auch eine Archivfunktion hat“, erklärt Wolfram. Es mache einen Unterschied, welche Geschichten archiviert und welche Erinnerungen aktiv geschaffen werden und welche nicht. „Für uns gab es viele unterrepräsentierte Geschichten.“

Die Überschneidung von Sozialwissenschaft und Film ermöglichte einen breiteren Zugang zur Thematik. Für beide stand im Fokus, unterschiedliche Lebensrealitäten aufzuzeigen, Filme zu machen, die angeschaut werden und die im besten Fall einen Dialog über gesellschaftliche Grenzen hinweg ermöglichen. Als erster Kurzspielfilm entstand Walter L., der seine erfolgreiche Österreich-Premiere im März bei der Diagonale feierte. Im Mittelpunkt der Handlung steht Walter, ein LKW-Fahrer, dessen Arbeit durch die Automatisierung von Prozessen stark beeinflusst wird. Plötzlich muss er seinen Arbeitsalltag mit einer Maschine und nicht mehr mit einer Person koordinieren, die Verständnis für seine familiäre Situation hat. Am Rande des filmischen Geschehens spielt sich eine Nationalratswahl ab, die den Film um eine politische Ebene ergänzt. Arbeit ist nicht nur in Walter L. ein zentraler Aspekt, von dem viel abhängt. Für Wolfram und Wagner gibt es hier einen klaren Spillover-Effekt: Arbeit sichert nicht nur die eigene Existenz, sondern wirkt sich auch auf soziale Beziehungen und die Familie aus und definiert wichtige Bereiche außerhalb des Arbeitsplatzes. Auch werden gesellschaftliche Autoritäts- und Hierarchiebeziehungen rund um Arbeit generiert. „Spannend war für uns, dass man über Arbeit forscht, während man selbst ja auch arbeitet“, hält Wolfram fest. „Und sich selbst in einem befristeten Arbeitsverhältnis befindet“, ergänzt Wagner.
Der Beruf LKW-Fahrer wurde bewusst gewählt. Galt der Beruf vor einigen Jahren noch als angesehene und stabile Beschäftigung, steht dieser nun von mehreren Seiten unter Druck. „LKW-Fahrer war für uns ein Nexus an Transformationen. Es werden Themen wie Automatisierung, Migration, Lohn-Dumping, E-Mobilität und vieles mehr in einem Beruf gebündelt“, hält Wagner fest. Ein besonderer Glücksfall war auch Hauptdarsteller Thomas Frank, der selbst vor Jahren als LKW-Fahrer tätig war.
Anfang März wurde der zweite Film Dina B. gedreht. In diesem wird eine Mitarbeiterin einer Agentur des AMS in den Fokus gerückt, die sich stets aufopfernd um ihre Klientinnen kümmert, aber zwischen Vorgaben des Systems und den tatsächlichen Bedürfnissen von langzeitarbeitssuchenden Frauen zu zerbrechen droht. „Für uns waren beim zweiten Film jene Personen spannend, die das System zusammenhalten und die Frage, wie sehr man sich selbst für das System ausbluten muss, damit dieses weiter funktioniert“, erklärt Wolfram die Themenwahl.

Um Forscher_innen, Filmemacher_innen und Autor_innen an einem Ort zusammenzubringen und gemeinsam Erkenntnisse zu den Themen Arbeit, Klasse und Politisierung zu diskutieren, wurde im April 2024 die Konferenz Arbeit – soziale Klasse – Politik – Film an der mdw abgehalten. Für die von Wolfram und Wagner selbst organisierte Konferenz konnten renommierte Gäste aus Film und Sozialwissenschaft gewonnen werden: etwa die Filmemacher Ken Loach und Paul Laverty (I, Daniel Blake; The Old Oak), Regisseurin Annika Pinske (Alle reden übers Wetter), Soziologin Michèle Lamont (Harvard University) aber auch Didier Eribon, der sein neues Buch Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben präsentierte.
Mit dem Projekt und den Filmen werden „gelebte Erfahrung“ auf die Leinwand gebracht und soziale Gruppen so abgebildet, dass viele diese nachvollziehen und sich im besten Fall selbst auch wiederfinden können. Mit ihrer Arbeit haben Barbara Wolfram und Paulus Wagner es geschafft, einen sozialwissenschaftlichen-filmischen Dialog zu ermöglichen und im wahrsten Sinne „Brücken zu bauen“.
Text: Carina Lampeter
Der Text ist im mdw Magazin Mai/Juni 2025 erschienen.